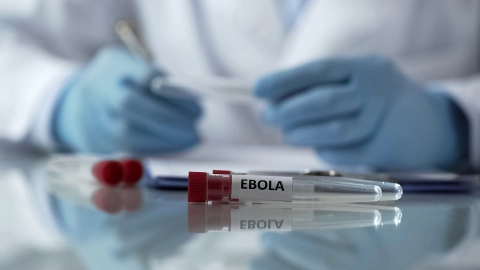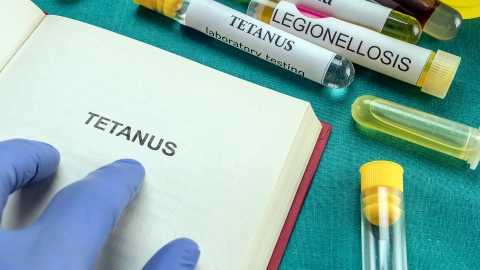Krankheiten Tollwut
ICD-Codes: A82 Was sind ICD-Codes?
Tollwut ist eine tödliche Viruserkrankung, die durch den Biss eines infizierten Tieres übertragen wird. Deutschland gilt als tollwutfrei. Wer in Länder reist, wo Tollwut noch vorkommt, kann sich vorbeugend impfen lassen. Jeder Tollwut-Verdacht erfordert eine sofortige Einleitung ärztlicher Maßnahmen.
Auf einen Blick
- Tollwut ist eine tödliche Virusinfektion, die durch den Biss von Tieren auf den Menschen übertragen wird.
- In Deutschland spielt die Erkrankung keine Rolle mehr. Es gibt aber Gebiete vor allem in Asien und Afrika, in denen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht.
- Die meisten Tollwut-Erkrankungen sind Folge von Bissen streunender Hunde.
- Jeder Verdacht muss schnellstmöglich im Krankenhaus abgeklärt werden. Wichtig ist, dass Maßnahmen eingeleitet werden, bevor Symptome auftreten.
- Wer in Tollwut-Risikogebiete reist, kann sich vorbeugend impfen lassen. Nach dem Biss eines potenziell infizierten Tieres sind weitere Impfdosen nötig.
Hinweis: Die Informationen dieses Artikels können und sollen einen Arztbesuch nicht ersetzen und dürfen nicht zur Selbstdiagnostik oder -behandlung verwendet werden.

Was ist Tollwut?
Die Tollwut (Rabies) ist eine Zoonose: Damit bezeichnet man Infektionskrankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden.
Verursacht wird die Erkrankung durch eine Infektion mit dem Rabiesvirus. Menschen stecken sich meist an, wenn sie von einem infizierten Tier gebissen werden. Die meisten Tollwut-Erkrankungen sind Folge von Bissen streunender Hunde.
Wo kommt Tollwut vor?
Tollwut ist in weiten Teilen der Welt verbreitet. Vor allem bei Reisen nach Afrika und Asien besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko.
In den meisten Ländern Europas konnte die Tollwut bei Wild- und Haustieren erfolgreich bekämpft werden. Deutschland gilt seit 2008 als tollwutfrei.
Bei adoptierten Haustieren aus dem Ausland, deren Herkunft unbekannt ist, lässt sich ein Infektionsrisiko jedoch nicht ausschließen.
Wie häufig tritt Tollwut auf?
Tollwut zählt zu den meldepflichtigen Infektionskrankheiten. In Deutschland wurde die letzte Tollwut-Erkrankung im Jahr 2007 registriert. Es handelte sich dabei um eine Person, die bei einer Reise in Nordafrika von einem streunenden Hund gebissen worden war.
Wie viele Menschen sterben an Tollwut?
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass weltweit jährlich rund 60.000 Menschen an Tollwut sterben – wobei die Dunkelziffer vermutlich hoch ist. Die meisten Fälle treten in Asien und Afrika auf.
Wie wird Tollwut übertragen?
Tollwut wird durch eine Infektion mit dem Rabiesvirus verursacht. Potenzielle Überträger der Tollwut sind vor allem streunende Hunde. Vereinzelt übertragen auch Wildtiere wie Fledermäuse, Füchse und Affen Tollwut.
Menschen können sich mit Tollwut anstecken, wenn sie von einem infizierten Tier gebissen werden und so in Kontakt mit virenhaltigem Speichel kommen. Seltener können auch Hautverletzungen oder Schürfwunden Eintrittspforten für die Viren sein, wenn diese mit dem Speichel des Tieres in Berührung kommen.
Es ist möglich, dass Tollwut von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Das passiert jedoch selten.
Was passiert nach der Infektion im Körper?
Zunächst verbleiben die Viren einige Zeit am Ort der Verletzung. Später wandern sie entlang der Nervenbahnen zum zentralen Nervensystem (ZNS) – also in Rückenmark und Gehirn. Dort vermehren sie sich massiv, was zu neurologischen Symptomen wie Lähmungen führt. Schließlich verbreiten sich die Viren über Nerven, die außerhalb des ZNS liegen, in andere Organe. Bei tiefen Bisswunden können die Viren direkt in das Blut übertreten. Sie gelangen dann schneller zum Gehirn und rufen frühzeitiger Symptome hervor.
Wie lässt sich Tollwut vorbeugen?
Um einer Tollwut-Infektion vorzubeugen, ist es wichtig, Abstand zu streunenden Hunden und wildlebenden Tieren wie Fledermäusen, Füchsen und Affen zu halten. So verringert man das Risiko, von einem potenziell infizierten Tier gebissen zu werden.
Wildlebende Tiere sind meist menschenscheu. Zu Beginn einer Tollwut-Erkrankung verlieren sie aber oft diese Scheu. Dann ist besondere Vorsicht geboten.
Kann man sich gegen Tollwut impfen lassen?
Wer in Gebiete reist, in denen Tollwut vorkommt, kann sich und seine Kinder vorbeugend dagegen impfen lassen. Medizinerinnen und Mediziner sprechen hier auch von einer präexpositionellen Impfung – also einer Impfung vor Kontakt mit dem Erreger. Ob solch eine Impfung sinnvoll ist, kann man vorab mit einer Ärztin oder einem Arzt besprechen.
Impfempfehlungen
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine vorbeugende Tollwut-Impfung mit drei Impfdosen. Dieses Schema ist für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland verbindlich.
Laut den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) reichen bei Menschen mit einem gesunden Immunsystem bereits zwei Impfdosen zur Vorbeugung aus. Nach diesem Schema kann nach entsprechender Aufklärung auch in Deutschland geimpft werden.
Video Wie funktioniert eine Impfung?
Im folgenden Video erfahren Sie, wie eine Impfung funktioniert.
Dieses und weitere Videos gibt es auch auf YouTube
Jetzt ansehenEs gelten die dort bekanntgegebenen Datenschutzhinweise.
Was muss ich tun, wenn ich auf Reisen gebissen wurde?
Ist es auf Reisen zu Kontakt mit einem tollwutverdächtigen Tier gekommen, sollte unverzüglich ein Arzt oder eine Ärztin aufgesucht werden.
Um die Wahrscheinlichkeit einer Tollwut-Übertragung einzuschätzen, spielen folgende Faktoren eine Rolle:
- Mit welcher Tierart kam Kontakt zustande?
Tollwut kann nur von Säugetieren übertragen werden. - In welchem Land ist es zu dem Kontakt gekommen?
Gilt ein Land als tollwutfrei, ist die Wahrscheinlichkeit der Übertragung gering. - Welche Art von Kontakt gab es?
Hat man das Tier nur berührt, besteht eine geringere Übertragungsgefahr, als wenn man gebissen wurde. - Besteht eine Tollwutimpfung?
Wenn man geimpft ist, werden andere Maßnahmen ergriffen als bei Ungeimpften. - Welche Maßnahmen wurden bereits ergriffen?
Das weitere Vorgehen ist abhängig davon, ob bereits eine Impfung oder Behandlung begonnen wurde.
Ist eine Tollwut-Übertragung wahrscheinlich, sollte sofort mit einer postexpositionellen Impfung begonnen werden. Auf den Nachweis von Tollwut-Erregern sollte nicht gewartet werden, um möglichst wenig Zeit zu verlieren. Wenn die Impfung unverzüglich erfolgt, bietet sie einen nahezu vollständigen Schutz gegen Tollwut.
Weiterhin sollten Maßnahmen zur Wundversorgung durchgeführt werden. Dazu zählen:
- Die Erreger aus der Biss- oder Kratzwunde auswaschen.
- Die Wunde sofort und ausgiebig mit Wasser und Seifenlösung reinigen.
- Die Wunde mit einer Sonde spülen, falls diese tief ist.
- Die Wunde nicht verätzen oder nähen.
Wichtig zu wissen: Die Zeit zwischen dem Kontakt mit dem Virus und dem Ausbruch der Krankheit kann mehrere Monate dauern. Daher ist eine Impfung auch später noch sinnvoll – allerdings nur, solange sich keine Symptome zeigen. Solch eine Impfung kommt beispielsweise infrage, wenn vor Ort kein Impfstoff verfügbar ist.
Welche Symptome treten bei Tollwut auf?
Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen der Übertragung und dem Ausbruch der Erkrankung, liegt für Tollwut in der Regel bei 3 bis 8 Wochen. In Einzelfällen können wenige Tage oder mehrere Jahre zwischen der Übertragung und dem Ausbruch vergehen.
Die Dauer hängt vor allem davon ab, an welcher Körperstelle man gebissen wurde: Je näher die Bissstelle am Kopf oder dem Rückenmark liegt, desto kürzer ist die Inkubationszeit.
Je nachdem, in welcher Phase sich die Erkrankung befindet, treten unterschiedliche Symptome auf.
Phase 1: Vorstadium oder Prodromalstadium
Zu Beginn ähnelt die Tollwut einer grippeähnlichen Erkrankung. Patientinnen und Patienten fühlen sich schwach und erschöpft. Sie haben Kopfschmerzen und keinen Appetit; manchen ist übel und sie müssen sich erbrechen. Der Bereich um die Bisswunde ist zudem häufig schmerzempfindlich, brennt und juckt.
Phase 2: Akutes neurologisches Stadium
In dieser Phase greift das Virus die Nervenzellen im Gehirn oder Rückenmark an. Mit der Zeit sterben diese Zellen ab.
Je nachdem, welche Nervenzellen betroffen sind, macht sich das unterschiedlich bemerkbar:
- Hirnentzündliche (enzephalitische) Form: Sie betrifft vor allem das Gehirn. Sie äußert sich durch eine ausgeprägte Furcht vor Wasser. Bereits das Hören oder Sehen von Wasser macht unruhig und ängstlich, führt gar zu Krämpfen in der Schluckmuskulatur. Die Krämpfe können sich von der Schluckmuskulatur über den ganzen Körper ausbreiten. Weil zudem mehr Speichel produziert wird, fließt dieser aus dem Mund. Die Stimmung erkrankter Personen wechselt zwischen aggressiv und depressiv.
- Lähmende (paralytische) Form: Sie betrifft vor allem das Rückenmark und die Nerven, die zu den Muskeln und Organen führen. Diese Form drückt sich durch Missempfindungen aus oder durch Muskelschwäche und Lähmungen. Diese können sowohl zu Schluckbeschwerden führen als auch die Atemmuskulatur betreffen.
Phase 3: Endstadium
In der letzten Erkrankungsphase verliert der Teil des Gehirns, der die Atmung und den Blutkreislauf steuert, seine Funktion. Erkrankte fallen zunächst ins Koma und sterben später infolge einer gelähmten Atem- oder Herzmuskulatur. Zwischen dem Auftreten der ersten Symptome und dem Tod liegen oft nur wenige Tage.
Wie wird Tollwut nachgewiesen?
Der Nachweis von Tollwut-Erregern kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Der Arzt oder die Ärztin kann zum Beispiel Blut und Nervenwasser (Liquor) entnehmen. Nervenwasser ist eine Flüssigkeit, die Gehirn und Rückenmark umgibt. In den Proben lassen sich bei Betroffenen Antikörper gegen Tollwut nachweisen. Antikörper produziert der Körper, um Tollwut-Erreger abzuwehren. Der Nachweis der Erreger gelingt auf diese Art jedoch nicht immer verlässlich.
Eine verlässlichere Methode ist der Nachweis der Erbinformation des Tollwut-Virus. Hierfür wird bevorzugt eine Gewebeprobe aus der Nackenhaut entnommen und im Labor untersucht.
Kann eine Tollwut-Erkrankung behandelt werden?
Besteht der Verdacht, dass die Tollwut-Erkrankung ausgebrochen ist, muss die Versorgung in einem Krankenhaus mit intensivmedizinischer Station in die Wege geleitet werden.
Derzeit gibt es keine wirksame Behandlung gegen eine Tollwut-Erkrankung. Das Ziel der Versorgung auf der Intensivstation ist es, die Beschwerden der Betroffenen möglichst zu lindern. Letztendlich endet eine Tollwut-Erkrankung immer tödlich.
- Fooks, A.R., et al.: Current status of rabies and prospects for elimination. Lancet 2014. 384: 1389-99. doi: 10.1056/NEJMoa050382. Aufgerufen am 07.03.2023.
- Malerczyk, C., et al.: Imported human rabies cases in Europe, the United States, and Japan, 1990 to 2010. J Travel Med. 2011; 18: 402-7. doi: 10.1111/j.1708-8305.2011.00557.x. Aufgerufen am 07.03.2023.
- Robert Koch-Institut (RKI). Epidemiologisches Bulletin. 14/2022. Aufgerufen am 07.03.2023.
- Robert Koch-Institut (RKI). Epidemiologisches Bulletin. 39/2022. Aufgerufen am 07.03.2023.
- Robert-Koch-Institut (RKI). Häufig gestellte Fragen zu Tollwut und Schutzimpfung gegen Tollwut. Aufgerufen am 07.03.2023.
- Robert Koch-Institut (RKI). RKI-Ratgeber: Tollwut. Aufgerufen am 07.03.2023.
- Rothe C et al. Reiseimpfungen - Hinweise und Empfehlungen. Flug u Reisemed 2023, 30: 52-85. Aufgerufen am 08.02.2024.
Geprüft durch die Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit (DTG).
Stand: