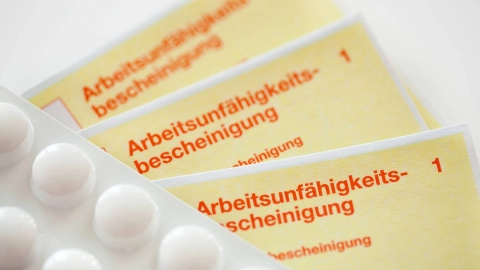Gesundheitsversorgung Wenn Eltern krank sind: Möglichkeiten der Unterstützung
Wenn ein Elternteil krank wird, kann das den Alltag der Familie stark durcheinanderbringen. Fällt ein Elternteil länger aus, stehen verschiedene Unterstützungsangebote zur Verfügung. Auch bei einer chronischen Erkrankung oder Behinderung können Familien im Alltag begleitet und entlastet werden.
Auf einen Blick
- Verschiedene Angebote unterstützen Eltern im Krankheitsfall. Bei akuter Krankheit oder nach einer Operation kann man eine Haushaltshilfe bei der Krankenkasse beantragen.
- Reicht die Haushaltshilfe nicht aus oder wird nicht bewilligt, kann das Jugendamt eine ambulante Familienpflege vermitteln. Dabei unterstützt eine Fachkraft Familien im Alltag, etwa bei der Betreuung der Kinder und im Haushalt.
- Eltern mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung können eine Eltern-Assistenz beantragen.
- Bei Überforderung im Familienalltag, etwa durch eine psychische Erkrankung oder Sucht, bieten Angebote des Jugendamts Unterstützung.
- Angebote der Frühen Hilfen können Familien ab der Schwangerschaft bis zum 3. Geburtstag unterstützen, besonders in belasteten Lebenslagen.
- Ehrenamtliche Angebote wie Patenschaften können eine wichtige Ergänzung sein – beispielsweise für Kinder psychisch erkrankter oder suchtkranker Eltern.

Wenn Eltern krank werden
Eltern stemmen im Alltag oft eine ganze Menge – besonders berufstätige Mütter und Väter jonglieren zwischen Job, Haushalt und Kinderbetreuung. Wird ein Elternteil plötzlich krank, bringt das den gewohnten Ablauf schnell ins Wanken. Die Familie steht dann vor der Herausforderung, den Alltag neu zu strukturieren und Hilfe zu organisieren.
Auch eine chronische Erkrankung oder Behinderung eines Elternteils verändert den Familienalltag oft grundlegend. Kinder übernehmen dann manchmal früh Verantwortung und es kann zu Belastungen oder Unsicherheiten kommen. Auch emotionale Herausforderungen wie Sorgen, Ängste oder das Gefühl, „anders“ zu sein, können verunsichern.
Gerade in solchen Situationen brauchen Familien Unterstützung, um den Familienalltag zu bewältigen und Kinder zu begleiten. Je nach Situation gibt es verschiedene Hilfsangebote, die betroffene Eltern entlasten und Kinder in ihrer gesunden Entwicklung unterstützen. Unser Artikel gibt Ihnen einen Überblick zu verschiedenen Hilfsangeboten für Familien, wenn Eltern vorübergehend oder längerfristig krank sind.
Haushaltshilfe: Vorübergehende Unterstützung im Haushalt
Im akuten Krankheitsfall kann es hilfreich sein, Freunde, Verwandte oder Nachbarn einzubinden – sei es für Einkäufe, Haushaltsaufgaben oder die Betreuung der Kinder. Doch nicht immer ist eine solche Unterstützung möglich. Eine Haushaltshilfe kann sich dann unter bestimmten Voraussetzungen um anfallende Tätigkeiten im Haushalt kümmern. Sie übernimmt beispielsweise alltägliche Aufgaben wie Wäsche waschen, putzen, einkaufen oder kochen. Je nach Bedarf unterstützt sie auch bei der Betreuung der Kinder.
In welchen Fällen trägt die Krankenkasse die Kosten für eine Haushaltshilfe?
Eltern haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine Haushaltshilfe. Wichtig ist:
- Es muss ärztlich bescheinigt werden, dass man den Haushalt aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen kann.
- Es lebt ein Kind unter zwölf Jahren oder ein hilfsbedürftiges behindertes Kind im Haushalt.
- Im Haushalt lebt keine andere Person, die den Haushalt übernehmen kann.
Es ist ratsam, sich möglichst frühzeitig an die Krankenkasse zu wenden, um eine Haushaltshilfe zu beantragen. Eine rückwirkende Antragsstellung ist nicht möglich.
Gut zu Wissen: Auch unabhängig von Kindern im Haushalt besteht für alle Versicherte ein Anspruch auf eine Haushaltshilfe, wenn man den Haushalt wegen schwerer Krankheit oder wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung nicht weiterführen kann. Voraussetzung hierfür ist, dass die Person nicht pflegebedürftig mit einem Pflegegrad 2 bis 5 ist und eine im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann.
Einige Krankenkassen bieten darüber hinaus freiwillige Leistungen (sogenannte Satzungsleistungen) an und unterstützen Familien auch, wenn Kinder zwischen 12 und 14 Jahren im Haushalt leben. Es lohnt sich also, direkt bei der eigenen Krankenkasse nachzufragen.
Wer kann die Haushaltshilfe übernehmen?
Nach einer Genehmigung muss die Krankenkasse dafür Sorge tragen, eine Haushaltshilfe zu organisieren. Wenn die Krankenkasse dies nicht tun kann oder ein Grund besteht, davon abzusehen, dann kann man sich auch selbst eine Haushaltshilfe beschaffen. Meist wird das gewünscht, wenn der oder die Versicherte Wert darauf legt, dass eine Person ihres Vertrauens den Haushalt weiterführt. Die entstandenen Kosten kann man sich anschließend von der Krankenkasse erstatten lassen.
Welche Kosten werden übernommen?
Grundsätzlich übernimmt die Krankenkasse die Kosten in angemessener Höhe. Übernehmen Ehepartner oder nahe Angehörige die Aufgaben im Haushalt, beteiligt sich die Krankenkasse nur an den Kosten, wenn Fahrtkosten oder ein Verdienstausfall nachgewiesen werden. Damit die Kosten erstattet werden können, dürfen sie in der Regel nicht höher sein als das, was eine professionelle Haushaltshilfe kosten würde. Die Ausgaben müssen also angemessen und vergleichbar sein. Als nahe Angehörige zählen dabei verwandte oder verschwägerte Personen bis zum 2. Grad, also beispielsweise Eltern, Großeltern, Geschwister oder die Schwägerin beziehungsweise der Schwager.
Welche Aufgaben kann die Haushaltshilfe übernehmen?
Eine Haushaltshilfe übernimmt Tätigkeiten, die für die Weiterführung des Haushalts unvermeidlich und zwangsläufig sind. Dazu gehören zum Beispiel: Einkaufen, Kochen, Waschen, Bügeln, Nähen, Reinigen und Pflegen von Wäsche, Kleidung und Wohnung. Die Haushaltshilfe unterstützt auch in der Kinderbetreuung – also beim Versorgen und Beaufsichtigen der Kinder.
Wie lange gibt es die Unterstützung und muss etwas zugezahlt werden?
Eine Haushaltshilfe kann pro Krankheitsfall für bis zu 4 Wochen beantragt werden. Lebt im Haushalt jedoch ein Kind unter 12 Jahren oder ein Kind mit einer Behinderung, verlängert sich der Anspruch auf bis zu 26 Wochen.
Für die Haushaltshilfe müssen für jeden Tag 10 Prozent der Kosten zugezahlt werden, mindestens jedoch 5 Euro und maximal 10 Euro pro Tag. Wenn man die Haushaltshilfe im Rahmen einer Schwangerschaft oder nach der Geburt benötigt, entfällt die Zuzahlung.
Was ist eine Familienpflegefachkraft?
Wenn Eltern krank sind und Unterstützung im Alltag brauchen, kann auch eine Familienpflegefachkraft helfen. Diese Fachkräfte sind speziell ausgebildet und unterstützen neben Tätigkeiten im Haushalt auch die Betreuung der Kinder.
Wird die Hilfe nur für einen begrenzten Zeitraum benötigt, übernimmt unter Umständen die Krankenkasse die Kosten im Rahmen einer Haushaltshilfe. Dafür muss man einen entsprechenden Antrag stellen und eine ärztliche Bescheinigung vorlegen.
In manchen Fällen kann eine Familienpflegefachkraft auch längerfristig im Rahmen der ambulanten Familienpflege unterstützen. Mehr dazu erfahren Sie im nächsten Abschnitt.
Ambulante Familienpflege: Praktische Unterstützung in Notsituationen
Es gibt Notsituationen, in denen Eltern oder Alleinerziehende die Betreuung und Versorgung ihrer Kinder nicht mehr allein bewältigen können. Das kann etwa sein, wenn ein Elternteil plötzlich durch Krankheit ausfällt oder eine alleinerziehende Mutter durch eine chronische Erkrankung im Alltag mit ihren Kindern Unterstützung benötigt. In solchen Fällen kann die ambulante Familienpflege helfen, wenn mindestens ein Kind unter 14 Jahren im Haushalt lebt. Diese Unterstützung ist kostenlos.
Ziel der ambulanten Familienpflege ist es, dass das Kind oder die Kinder in schwierigen Situationen weiterhin in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können und der vertraute Tagesablauf möglichst erhalten bleibt. Die Familienpflegerin oder der Familienpfleger unterstützt überbrückend, wenn die Betreuung im Rahmen der Kita oder durch Familienangehörige nicht ausreichen.
Familienpflegerinnen und -pfleger übernehmen verschiedene Aufgaben. Hier einige Beispiele:
- Sie betreuen die Kinder zu Hause und spielen mit ihnen.
- Sie holen die Kinder von der Kita oder Schule ab.
- Sie begleiten Kinder zu Arztterminen, zum Sport oder zu anderen Terminen.
- Sie helfen bei den Hausaufgaben.
- Sie übernehmen Aufgaben im Haushalt.
Der zuständige Leistungsträger der ambulanten Familienpflege ist das Jugendamt. Es gibt verschiedene freie Träger, die ambulante Familienpflege anbieten – beispielsweise soziale und kirchliche Träger. Eingesetzt werden dabei entweder professionell ausgebildete Familienpflegerinnen und Familienpfleger oder geschulte ehrenamtliche Familienpaten.
Welche Voraussetzungen gibt es für eine ambulante Familienpflege?
Eine ambulante Familienpflege kann beantragt werden, wenn:
- ein Kind unter 14 Jahren im Haushalt lebt,
- der Elternteil, der sich überwiegend um die Betreuung des Kindes kümmert, aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen (zum Beispiel Inhaftierung oder Todesfall) ausfällt,
- der andere Elternteil oder Angehörige die Betreuung nicht übernehmen können,
- eine Kita-Betreuung allein nicht ausreicht,
- das Kind in seinem vertrauten Zuhause bleiben soll und
- die Krankenkasse keine Haushaltshilfe bezahlt oder die genehmigte Hilfe nicht ausreicht.
Wichtig zu Wissen: Wenn Eltern wegen gesundheitlicher Probleme Unterstützung brauchen, müssen sie zuerst bei ihrer Krankenkasse eine Haushaltshilfe beantragen. Diese Hilfe hat Vorrang. Nur wenn die Hilfe abgelehnt wird oder die genehmigte Hilfe in ihrem Umfang oder ihrer Dauer nicht ausreicht, kann zusätzlich eine ambulante Familienpflege über das Jugendamt beantragt werden. Eine Familienpflegerin oder ein Familienpfleger kann dann zum Beispiel stundenweise zusätzlich zur Haushaltshilfe unterstützen oder übernehmen, wenn der bewilligte Zeitraum für die Haushaltshilfe vorbei ist.
In welchem Umfang ist eine ambulante Familienpflege möglich?
In welchem Umfang eine ambulante Familienpflege genehmigt wird, richtet sich immer nach dem individuellen Bedarf der Familie und der Situation vor Ort. Beispielsweise kann eine Familienpflegerin oder ein Familienpfleger für wenige Stunden am Tag unterstützen, etwa um die Kinder morgens vorzubereiten und in die Schule oder den Kindergarten zu bringen sowie nachmittags abzuholen und zu betreuen. In anderen Fällen kann aber auch eine Betreuung rund um die Uhr notwendig sein, beispielsweise wenn eine alleinerziehende Mutter zur Kur fährt und eine Betreuung der Kinder anderweitig nicht möglich ist.
Die ambulante Familienpflege kann auch dann helfen, wenn bereits eine Haushaltshilfe von der Krankenkasse bewilligt wurde. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn die Unterstützung durch die Haushaltshilfe nicht ausreicht.
Ein Beispiel: Die Krankenkasse bezahlt in der Regel höchstens 8 Stunden pro Tag für eine Haushaltshilfe. Wenn aber mehr Betreuung nötig ist, zum Beispiel weil mehrere Kinder im Haushalt leben oder ein Kind besondere Unterstützung braucht, kann zusätzlich eine ambulante Familienpflegekraft helfen – etwa am späten Nachmittag oder am Wochenende.
Eine Haushaltshilfe wird außerdem in der Regel für höchstens 26 Wochen genehmigt, wenn ein Kind unter 12 Jahren oder ein auf Hilfe angewiesenes behindertes Kind im Haushalt lebt. Besteht danach noch weiterer Unterstützungsbedarf, kann diese im Rahmen einer ambulanten Familienpflege erfolgen.
Ein Beispiel: Eine Mutter ist nach einer Operation länger nicht in der Lage, den Haushalt zu führen und die Betreuung der drei Kinder zu übernehmen. Der Vater arbeitet in Vollzeit und kann daher nur begrenzt unterstützen. Die Haushaltshilfe der Krankenkasse endet nach 26 Wochen, aber die Mutter kann sich noch immer nicht allein um Kinder und Haushalt kümmern. In diesem Fall kann die ambulante Familienpflege so lange unterstützen, bis die Mutter sich von der Operation erholt hat.
Wie beantrage ich eine ambulante Familienpflege?
Wenn Eltern aus gesundheitlichen Gründen Unterstützung benötigen, muss in der Regel zuerst eine Haushaltshilfe bei der Krankenkasse beantragt werden. Wird der Antrag abgelehnt oder die bewilligte Hilfe reicht nicht aus, dann können sich Eltern oder Alleinerziehende an das zuständige Jugendamt wenden.
In einem Beratungsgespräch können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klären, welche konkrete Unterstützung sinnvoll ist und bei der Antragstellung unterstützen. Anschließend wird geprüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn die Hilfe bewilligt wird, vermittelt das Jugendamt in der Regel auch einen passenden Träger, der die ambulante Familienpflege übernimmt. Die Eltern oder Alleinerziehenden sprechen dann direkt mit dieser Organisation ab, wie viel Unterstützung gebraucht wird und wann die Familienpflegekraft kommen soll.
Auf der Webseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter können Sie nach dem Jugendamt in Ihrer Nähe suchen.
Wichtig zu Wissen: Es gibt auch andere Zugangswege zu ambulanter Familienpflege. Wird beispielsweise ein Elternteil im Krankenhaus behandelt, kann man sich an den Sozialdienst des Krankenhauses wenden. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann individuell dazu beraten, welche Unterstützungsmöglichkeiten infrage kommen und entsprechende Kontakte vermitteln. Der Sozialdienst unterstützt außerdem bei der Antragstellung.
Eltern-Assistenz: Unterstützung für Eltern mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen
Für Eltern mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung stellen sich im Familienalltag mitunter besondere Herausforderungen. In solchen Fällen kann eine Eltern-Assistenz unterstützen. Eine Eltern-Assistenz hilft unter anderem bei:
- der alltäglichen Betreuung und Versorgung der Kinder
- der Begleitung zu Terminen, zum Beispiel zum Kinderarzt oder zur Schule
- Aufgaben im Haushalt wie Einkaufen oder Aufräumen
Ziel einer solchen Assistenz ist es, Eltern in ihrer Selbstbestimmung und der Ausübung ihrer Elternrolle zu unterstützen. Der Umfang der Unterstützung richtet sich nach dem persönlichen Bedarf. Er hängt unter anderem ab von den persönlichen Einschränkungen, dem Alter und Unterstützungsbedarf der Kinder sowie den sonstigen Unterstützungsmöglichkeiten – etwa durch Angehörige.
Wer kann eine Eltern-Assistenz bekommen?
Eine Eltern-Assistenz ist möglich für Menschen mit:
- einer körperlichen Behinderung (zum Beispiel einer Gehbehinderung, Blindheit oder Gehörlosigkeit)
- einer psychischen Erkrankung (zum Beispiel einer Depression oder Suchterkrankung)
- chronischen Krankheiten (zum Beispiel Rheuma oder einer Krebserkrankung)
- Lernschwierigkeiten oder einer kognitiven Beeinträchtigung
Gut zu Wissen: Der Anspruch auf eine Eltern-Assistenz besteht auch, wenn nur ein Elternteil eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung hat.
Wie beantragt man eine Eltern-Assistenz?
Um eine Eltern-Assistenz zu erhalten, stellt man am besten einen schriftlichen Antrag beim zuständigen Leistungsträger. Meist ist das der Träger der Eingliederungshilfe. Welcher Träger zuständig ist, hängt von der persönlichen Situation ab. Auch wenn der Antrag versehentlich an die falsche Stelle geschickt wird, wird er an den zuständigen Leistungsträger weitergeleitet.
Welcher Leistungsträger in Ihrem Fall zuständig ist, können Sie mit dem Reha-Zuständigkeitsnavigator der Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR) herausfinden.
Im Antrag sollte der Elternteil möglichst genau aufschreiben, welche Beeinträchtigung sie oder er hat und wobei im Alltag Unterstützung benötigt wird.
Wichtig ist auch, dass alle nötigen Unterlagen mit dem Antrag mitgeschickt werden – zum Beispiel:
- ein Nachweis über die Behinderung oder Krankheit (zum Beispiel ein Schwerbehinderten-Ausweis oder eine ärztliche Bescheinigung)
- Nachweise über Einkommen und Vermögen
Einen Musterantrag sowie Hinweise zu notwendigen Nachweisen finden Sie ab Seite 98 in der Broschüre zur Eltern-Assistenz des Bundesverbands behinderter und chronisch kranker Eltern e.V.
Nach der Antragstellung erfolgt eine sogenannte Bedarfsermittlung: Dabei prüft der zuständige Leistungsträger, ob und wie viel Hilfe gebraucht wird. Um den genauen Unterstützungsbedarf abzuschätzen, kann beispielsweise ein Hausbesuch stattfinden oder man wird zu einem Gespräch eingeladen.
Gut zu Wissen: Es ist hilfreich, wenn bei dem Hausbesuch oder Gespräch eine Vertrauensperson dabei ist, die bei Bedarf unterstützen kann. Das kann zum Beispiel die Partnerin, der Partner, ein Familienangehöriger oder eine gute Freundin sein.
Es ist auch möglich, Eltern-Assistenz in Form eines sogenannten Persönlichen Budgets zu erhalten. Dabei erhält man anstelle der festgesetzten Leistung einen monatlichen Geldbetrag, mit dem man die Eltern-Assistenz selbst organisiert und bezahlt. Nähere Informationen finden Sie in unserem Artikel zum Persönlichen Budget.
Weiterführende Informationen zur Eltern-Assistenz finden Sie beim Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern e.V. Der Verein bietet zudem eine Broschüre zum Thema Eltern-Assistenz. Diese ist auch in Leichter Sprache verfügbar. Auf der Webseite findet sich außerdem eine deutschlandweite Suche nach einer Eltern-Assistenz.
Beratung zum Thema Eltern-Assistenz bietet unter anderem die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung.
Erziehungshilfe: Unterstützung von Familien in schwierigen Lebenslagen
Eltern können verschiedene Hilfen vom Jugendamt bekommen, wenn sie Unterstützung bei der Erziehung brauchen – sogenannte „Hilfen zur Erziehung“. Diese Hilfen reichen von Beratungsgesprächen bis hin zur Unterbringung in einem Heim, je nachdem, was individuell sinnvoll und notwendig ist.
Ziel dieser Erziehungshilfen ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und Eltern zu helfen, welche allein nicht mehr zurechtkommen. Die Unterstützung soll dabei helfen, schwierige Situationen zu meistern und das Aufwachsen und Wohlergehen der Kinder zu sichern.
Wer kann Hilfen zur Erziehung bekommen?
Es gibt verschiedene Situationen, in denen Erziehungshilfen Familien in schwierigen Lebenslagen unterstützen können. Möglich sind Erziehungshilfen unter anderem, wenn:
- Eltern den Familienalltag nicht mehr allein bewältigen können, beispielsweise, weil sie durch Armut oder anhaltende Arbeitslosigkeit belastet sind
- es zu Krisen kommt, zum Beispiel nach einer Trennung oder Scheidung oder durch Beziehungskonflikte
- ein Elternteil oder beide Eltern aufgrund einer psychischen Erkrankung oder Suchterkrankung ihr Kind nicht angemessen versorgen können
- Gewalt oder Vernachlässigung in der Familie vorkommt
- Kinder oder Jugendliche mit psychischen Problemen oder Auffälligkeiten reagieren, beispielsweise mit aggressivem, selbstverletzendem Verhalten oder mit einer Depression
- Kinder oder Jugendliche große Lernschwierigkeiten haben und womöglich öfters die Schule schwänzen
Erziehungshilfen kommen also immer dann infrage, wenn das Wohl von Kindern oder Jugendlichen gefährdet ist. Hilfen zur Erziehung können alle Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten erhalten. Es ist außerdem möglich, dass sich Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene selbstständig Hilfe beim Jugendamt holen – auch ohne das Wissen der Eltern.
Welche Hilfen sind möglich und wie werden sie beantragt?
Die Hilfen zur Erziehung umfassen verschiedene Unterstützungsangebote für Familien, Kinder und Jugendliche – je nach individuellem Bedarf der Familie.
Alle Familienmitglieder können sich bei einer Familien- oder Erziehungsberatung Unterstützung holen. Neben den Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten selbst können sich also auch Kinder und Jugendliche sowie andere Angehörige an eine Beratungsstelle wenden. Das Jugendamt bietet entweder selbst Beratungen an oder vermittelt an eine Beratungsstelle vor Ort.
Es ist auch möglich, sich direkt an eine Beratungsstelle zu wenden. Auf der Seite der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung kann man nach Beratungsstellen in der Nähe suchen.
Auf der Webseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter können Sie nach dem Jugendamt in Ihrer Nähe suchen.
Erziehungsberatungen sind freiwillig und kostenlos. Sie bieten eine leicht zugängliche Unterstützung zum Beispiel bei häufigem Streit in der Familie, in Trennungssituationen, bei Unsicherheiten in Erziehungsfragen oder wenn ein Kind auffälliges Verhalten zeigt. Aber auch viele weitere Beratungsthemen sind denkbar – je nach persönlicher Situation.
Wenn Familien eine intensivere Unterstützung benötigen, können sie beim Jugendamt einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung stellen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts schauen anschließend gemeinsam mit der Familie im Rahmen der sogenannten „Hilfeplanung“, welche Unterstützung genau gebraucht wird. Dafür finden in der Regel mehrere Gespräche statt, bevor eine längerfristige Hilfe geplant wird.
Gut zu wissen: Neben Eltern oder anderen Sorgeberechtigten können auch Menschen aus dem Umfeld eine Unterstützung durch das Jugendamt anregen – beispielsweise Lehrkräfte oder Erzieherinnen und Erzieher. Die Angebote des Jugendamts sind jedoch in der Regel freiwillig. Das heißt, die Eltern entscheiden selbst, ob sie die Hilfe annehmen möchten oder nicht. In besonderen Fällen gilt jedoch eine Ausnahme: Wenn das Wohl eines Kindes ernsthaft gefährdet ist, kann das Familiengericht den Eltern vorschreiben, dass sie eine Hilfe annehmen müssen.
Welche Form der Hilfe in einer Familie eingesetzt wird, kann sehr unterschiedlich aussehen. Je nachdem, was die Familie braucht, ist zum Beispiel möglich:
- eine ambulante Betreuung im gewohnten Umfeld: Dabei kommt regelmäßig eine sozialpädagogische Fachkraft in die Familie nach Hause oder begleitet die Kinder in ihrem Alltag. Sie unterstützt bei der Organisation des Familienalltags und in Erziehungsfragen. Außerdem hilft sie Kindern und Jugendlichen im Alltag klarzukommen, zum Beispiel in der Schule oder mit Freunden.
- eine teilstationäre Betreuung in einer Tagesgruppe: Das Kind ist an mehreren Tagen in der Woche nachmittags in einer Gruppe mit anderen Kindern.
- eine stationäre Betreuung in einer Wohngruppe oder Pflegefamilie: Dies ist eine wichtige Form der Hilfe, wenn das Kind vorübergehend nicht zu Hause wohnen kann.
Wer bietet Hilfen zur Erziehung an?
Die Hilfen werden in der Regel von freien Trägern der Jugendhilfe umgesetzt. Diese beschäftigen sozialpädagogische Fachkräfte, die Familien bestmöglich beraten, begleiten und unterstützen können.
Wer trägt die Kosten?
Alle ambulanten Hilfen zur Erziehung sind für Familien kostenlos. Die Stadt oder Gemeinde übernimmt in diesen Fällen die Kosten.
Wird das Kind beziehungsweise der Jugendliche teilweise oder ganz außerhalb der Familie betreut (zum Beispiel in einer Wohngruppe), müssen sich die leiblichen Eltern je nach Einkommen an den Kosten beteiligen. Bei geringem Einkommen ist ein Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes zu leisten.
Gut zu wissen: Junge Erwachsene, die in einer teilstationären Gruppe betreut werden oder in einer Einrichtung leben, müssen sich seit 2023 nicht mehr mit ihrem Einkommen oder Vermögen an den Kosten beteiligen. Nur bestimmte Leistungen wie Kindergeld, Rente oder anteilig BAföG werden angerechnet und als Beitrag einbezogen.
Weiterführende Informationen rund um das Thema Hilfen zur Erziehung finden Sie auf der Webseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter.
Frühe Hilfen: Praktische Unterstützung für junge Familien
Besonders in der Zeit mit kleinen Kindern – aber auch schon während der Schwangerschaft und nach der Geburt – gibt es viele Herausforderungen im Alltag. Für Familien mit Kindern bis 3 Jahren bieten die Frühen Hilfen zahlreiche Unterstützungsangebote. Diese Angebote sind kostenfrei zugänglich.
Diese Angebote richten sich insbesondere an Eltern oder Alleinerziehende, die
- sich im Alltag mit dem Kind oft überfordert, hilflos oder erschöpft fühlen
- das Gefühl haben, dass sie sich womöglich nicht ausreichend um Ihr Kind kümmern können
- sich mit ihrem Kind alleingelassen fühlen
- nicht mehr weiterwissen, weil das Baby viel schreit
- sich viel mit dem Partner oder der Partnerin streiten
Zu den Angeboten gehört die Begleitung durch eine Familienhebamme oder Familien-Kinderkrankenschwester.
Ausführliche Informationen zu den Frühen Hilfen finden Sie in unserem Artikel Unterstützung für Familien nach der Geburt.
Auf elternsein.info können Sie direkt nach Frühen Hilfen in der Nähe suchen.
Da das örtliche Jugendamt verantwortlich für den Aufbau Früher Hilfen ist, finden Sie auf der Webseite Ihres zuständigen Jugendamtes in der Regel auch die Kontaktdaten der örtlichen Anlaufstelle für Frühe Hilfen.
Auf der Webseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter können Sie nach dem zuständigen Jugendamt suchen.
Ehrenamtliche Angebote
Ehrenamtliche Unterstützung kann eine wichtige Ergänzung sein, um Familien im Alltag zu entlasten. Es gibt verschiedene Patenschafts- oder Unterstützungsangebote, bei denen Ehrenamtliche Familien begleiten. Diese Angebote richten sich teilweise an Eltern mit bestimmten Erkrankungen, zum Beispiel mit einer Suchterkrankung, einer psychischen Erkrankung oder Krebs.
Im Rahmen einer Patenschaft kümmern sich ehrenamtlich tätige Personen zum Beispiel regelmäßig um das Kind, spielen mit ihm, hören zu oder unternehmen etwas gemeinsam. So steht den Kindern eine verlässliche Bezugsperson zur Seite, wenn Eltern dies nicht immer bieten können.
Die Angebote sind regional unterschiedlich. Es lohnt sich, bei einer Erziehungsberatungsstelle oder einem Familienzentrum vor Ort nachzufragen, ob es in der Nähe passende Angebote gibt.
In Berlin vermittelt zum Beispiel das Projekt Vergiss mich nicht Patenschaften für Kinder von Eltern mit einer Suchterkrankung. Der AMSOC e.V. bietet Unterstützung durch Patenschaften für Kindern von Eltern mit einer psychischen Erkrankung.
Rat und Hilfe
Verschiedene Anlaufstellen bieten Beratung und Hilfe für Eltern, Alleinerziehende oder andere Sorgeberechtigte mit einer Erkrankung:
Das örtliche Jugendamt ist zuständig für alle Fragen rund um Erziehungshilfen, ambulante Familienpflege oder Kinderschutz.
Auf der Webseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter können Sie nach dem Jugendamt in Ihrer Nähe suchen.
Auch örtliche Erziehungs- und Familienberatungsstellen vermitteln weiterführende Hilfsangebote. Auf der Seite der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung kann man nach Beratungsstellen in der Nähe suchen.
Es ist auch möglich, sich bei freien Trägern der Jugendhilfe beraten zu lassen, beispielsweise bei Wohlfahrtsverbänden wie der Caritas, der Diakonie, dem DRK oder der Arbeiterwohlfahrt (AWO).
Sinnvoll ist mitunter, sich vor Ort an Familienzentren zu wenden. Diese bieten oft eine offene Beratung an und kennen lokale Unterstützungsangebote wie ehrenamtliche Patenschaften gut.
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung unterstützt in allen Fragen zur Teilhabe, beispielsweise bei Fragen zur Eltern-Assistenz.
Die Verbraucherzentralen und die Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) beraten unter anderem zu Patientenrechten und anderen gesundheitsrechtlichen Themen.
Außerdem unterstützen und beraten verschiedene Vereine und Initiativen Familien mit chronisch kranken Eltern:
Der Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern e.V. fördert den Erfahrungsaustausch zwischen Eltern, zum Beispiel durch regionale Austauschgruppen. Auf der Webseite finden sich außerdem hilfreiche Informationen für chronisch kranke oder behinderte Eltern.
Die Initiative Netz und Boden bietet Beratung für Familien mit psychisch kranken Eltern.
Eine deutschlandweite Suche nach ambulanten Hilfsangeboten für Familien mit suchtkranken Eltern bietet NACOA Deutschland - Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V.
Die Website Pausentaste bietet Informationen zu praktischer und psychologischer Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit kranken Eltern.
- Aktion Mensch. Familienratgeber.de. Eltern-Assistenz. Aufgerufen am 03.07.2025.
- Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter. Hilfen zur Erziehung. Aufgerufen am 03.07.2025.
- Bundesministerium für Justiz. Sozialgesetzbuch (SGB) - Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - § 38 Haushaltshilfe. Stand: 25.02.2025.
- Bundesministerium für Justiz. Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe. Stand: 03.04.2025.
- Bundesministerium für Justiz. Sozialgesetzbuch (SGB) - Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - § 78 Assistenzleistungen. Stand: 22.12.2023.
- Bundesverband behinderter-Eltern - bbe e.V. Eltern-Assistenz. Unterstützung für Eltern mit Behinderung und chronischen Erkrankungen. Stand: Mai 2019.
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen nach § 20 SGB VIII (Familienpflege) durch ambulante Pflegedienste. Stand: Juli 2017.
- Diakonie Deutschland und Deutscher Caritasverband. Familienpflege in den Frühen Hilfen. Stand: Mai 2016.
- Nationales Zentrum Frühe Hilfen. Eltersein.info. Was sind Frühe Hilfen? Aufgerufen am 03.07.2025.
- GKV Spitzenverband. Haushaltshilfe. Aufgerufen am 03.07.2025.
Geprüft durch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (VZ RLP) e.V.
Stand: