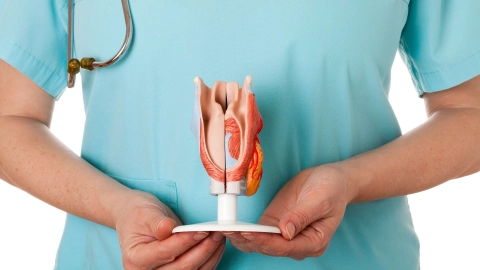Krankheiten Kehlkopfkrebs (Larynxkarzinom)
ICD-Codes: C32 Was sind ICD-Codes?
Bei Kehlkopfkrebs wachsen bösartige Tumoren in der Region der Stimmlippen. Besonders anhaltende Heiserkeit kann auf eine solche Krebserkrankung hinweisen. In diesem Beitrag erhalten Sie einen Überblick zu Risikofaktoren, Diagnostik und Behandlung von Kehlkopfkrebs.
Auf einen Blick
- Kehlkopfkrebs bezeichnet bösartige Tumoren, die an den Stimmlippen wachsen, aber auch oberhalb oder unterhalb davon.
- Fachleute bezeichnen Kehlkopfkrebs auch als Larynxkarzinom.
- Männer erkranken deutlich häufiger an Kehlkopfkrebs als Frauen.
- Das häufigste Symptom von Kehlkopfkrebs ist Heiserkeit.
- Tabak- und Alkoholkonsum gelten als Hauptrisikofaktoren für die Entstehung von Kehlkopfkrebs.
- Mögliche Behandlungen bei Kehlkopfkrebs sind Operation, Strahlentherapie, Chemotherapie und eventuell Immuntherapie.
Hinweis: Die Informationen dieses Artikels können und sollen einen Arztbesuch nicht ersetzen und dürfen nicht zur Selbstdiagnostik oder -behandlung verwendet werden.

Was ist Kehlkopfkrebs?
Unter Kehlkopfkrebs versteht man bösartige Tumoren, die an den Stimmlippen wachsen, aber auch oberhalb und unterhalb davon. Diese Krebserkrankungen gehen meist von der Schleimhaut aus, die den Kehlkopf von innen auskleidet. Fachleute bezeichnen Kehlkopfkrebs auch als Larynxkarzinom.
Der Kehlkopf liegt im vorderen Halsbereich, etwa auf mittlerer Höhe, und bildet den Übergang vom Rachen zur Luftröhre. Zum einen sorgt er dafür, dass kein Essen oder Trinken in die Luftröhre gelangt – er schützt also vor dem Verschlucken. Zum anderen ermöglicht er durch seine Stimmlippen die Entstehung von Tönen und dadurch das Sprechen.
Fachleute unterteilen Kehlkopftumoren in drei Gruppen, je nachdem wo sie wachsen:
- an den Stimmlippen
- oberhalb der Stimmlippen
- unterhalb der Stimmlippen
Kehlkopfkrebs gehört wie auch Mundhöhlenkrebs und Rachenkrebs zu den Kopf-Hals-Tumoren. Es handelt sich um einen eher seltenen Tumor: Pro Jahr erkranken in Deutschland rund 3.200 Menschen. Männer sind deutlich häufiger von Kehlkopfkrebs betroffen als Frauen.
Welche Symptome verursacht Kehlkopfkrebs?
Welche Beschwerden Kehlkopfkrebs verursacht, hängt davon ab, wo der Krebs im Kehlkopf entsteht. Wachsen Kehlkopftumoren an den Stimmlippen, fallen sie meist frühzeitig durch Heiserkeit auf. Wachsen Tumoren ober- oder unterhalb der Stimmlippen, verursachen sie oft erst spät Symptome. Das sind dann vor allem Schluckbeschwerden und Atemprobleme.
Folgende Warnzeichen können auf einen Tumor am Kehlkopf hinweisen:
- Heiserkeit
- bleibendes, vor allem einseitiges Fremdkörpergefühl
- Schmerzen, die ins Ohr ausstrahlen
- Störungen beim Schlucken, beispielsweise Verschlucken
- Schmerzen beim Schlucken
- Schwellung am Hals
- Schwierigkeiten beim Sprechen
- Schwierigkeiten beim Atmen
- unklarer blutiger Husten
- Mundgeruch
Bestehen diese Beschwerden länger als vier Wochen? Spätestens dann empfiehlt sich ein Arztbesuch. Hausärztinnen und Hausärzte können die Auslöser der Symptome bereits gut eingrenzen und bei Bedarf weitere Untersuchungen bei Fachärztinnen und Fachärzten einleiten.
Kehlkopfkrebs: Welche Ursachen und Risikofaktoren gibt es?
Kehlkopfkrebs basiert wie fast jede Krebserkrankung auf genetischen Veränderungen. Durch diese verwandeln sich normale Körperzellen in bösartige Krebszellen und beginnen unkontrolliert zu wachsen. Die meisten dieser Genveränderungen entstehen im Laufe des Lebens zufällig. Es gibt aber Risikofaktoren, die Kehlkopfkrebs begünstigen.
Zu den bekannten Risikofaktoren zählen:
- regelmäßiges Rauchen
- übermäßiger Alkoholkonsum
- Asbeststaubbelastung
- Belastung mit Schadstoffen wie ionisierender Strahlung (etwa Uran), schwefelsäurehaltigen Aerosolen, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Steinkohle oder Teerprodukten
- bei einem kleineren Teil der Patienten Infektionen mit humanen Papillomviren (HPV), insbesondere mit dem Hochrisiko-Typ HPV 16
- Krebsvorstufen – bestimmte weißliche (Leukoplakie oder Pachydermie) oder rötliche Veränderungen (Erythroplakie) der Kehlkopfschleimhaut
Tabak- und Alkoholkonsum sind die Hauptrisikofaktoren und gemeinsam konsumiert besonders schädlich. Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass auch eine Mangelernährung oder der vermehrte Verzehr von Fleisch oder von gebratenem Essen das Risiko für Kehlkopfkrebs erhöhen können.
Wie verläuft eine Krebserkrankung des Kehlkopfs?
Kehlkopfkrebs kann sich aus Krebsvorstufen entwickeln. Das sind Gewebeveränderungen, deren Zellen gegenüber dem Ursprungsgewebe verändert sind. Wachsen diese veränderten Zellen zerstörend in die Tiefe des Gewebes, hat sich ein bösartiger Kehlkopftumor entwickelt. Er kann in andere Organe streuen (metastasieren).
Je nach Ursprungsort des Tumors unterscheidet sich die weitere Ausbreitung und auch der Krankheitsverlauf des Kehlkopfkrebs:
- Kehlkopftumoren, die an den Stimmlippen wachsen, entwickeln in frühen Krankheitsstadien nur selten Lymphknotenmetastasen.
- Kehlkopftumoren, die ober- oder unterhalb der Stimmlippen wachsen, breiten sich oft schon frühzeitig in die Halslymphknoten aus.
Über das Blut streut Kehlkopfkrebs vor allem in die Lunge, während sich in Knochen und der Leber seltener Metastasen ansiedeln. Die Hauptrisikofaktoren Tabak und Alkohol können eine weitere, zweite Krebserkrankung im Kopf-Hals-Bereich begünstigen: Meist entsteht dann Lungenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Krebs des Mundraums oder des Rachens.
Wie kann ich Kehlkopfkrebs vorbeugen?
Die wirksamste Maßnahme, um das persönliche Risiko für Kehlkopfkrebs zu senken, besteht darin, auf Tabak und Alkohol zu verzichten.
Wie wird Kehlkopfkrebs diagnostiziert?
Wenn der Verdacht auf Kehlkopfkrebs besteht, befragt die Ärztin oder der Arzt Patienten zunächst zu ihren Beschwerden, möglichen vorliegenden Risikofaktoren und ihrem allgemeinen Gesundheitszustand. Nach dieser sogenannten Anamnese folgen Untersuchungen.
Körperliche Untersuchung und Biopsie
Zunächst erfolgt eine genaue Hals-Nasen-Ohren-ärztliche Untersuchung. Besteht nach dieser Untersuchung der Verdacht auf einen bösartigen Tumor des Kehlkopfs? Dann entnimmt die Ärztin oder der Arzt Gewebeproben (Biopsien) aus verdächtigen Bereichen, um diese feingeweblich untersuchen zu lassen. Dafür bekommt die Patientin oder der Patient in der Regel eine Vollnarkose. Darüber hinaus untersuchen Ärzte zusätzlich die oberen Luft- und Speisewege. Dies soll mögliche Zweittumoren ausschließen.
Wichtig zu wissen: Bei kleinen Gewebeveränderungen entnehmen die Ärzte keine Gewebeprobe, sondern entfernen den verdächtigen Bereich direkt vollständig. Dies erspart Betroffenen wahrscheinlich einen späteren zweiten Eingriff. Zuvor kann eine Untersuchung der Stimmlippenfunktion sinnvoll sein. Das soll ausschließen, dass der Tumor in die Tiefe des Gewebes wächst.
Die entnommenen Gewebeproben werden im Labor unter dem Mikroskop und mit molekularbiologischen Tests auf ihre feingeweblichen und biologischen Eigenschaften untersucht. Ergibt die Analyse der Biopsie, dass die Zellen bösartig verändert sind, handelt es sich um Kehlkopfkrebs.
Bildgebende Untersuchungen
Untersuchungen, die Bilder vom Körperinneren erzeugen, helfen Ärztinnen und Ärzten abzuschätzen, wie weit sich der Tumor ausgebreitet hat. So können sie auch herausfinden, ob der Krebs bereits Metastasen in Halslymphknoten oder weiter entfernten Geweben (Organen und/oder Lymphknoten) gebildet hat oder ob es weitere Tumoren (Zweittumore) gibt. Dafür werden folgende bildgebende Verfahren eingesetzt:
- eine Magnetresonanztomographie (MRT)
- eine Computertomographie (CT)
- eine Positronen-Emissions-Tomographie (PET/CT)
- ein Ultraschall des Halses und gegebenenfalls des Bauchraums.
Ist es nicht eindeutig möglich, die Halslymphknoten durch bildgebende Verfahren zu beurteilen? Dann können Ärzte eine zusätzliche Feinnadelbiopsie (Punktion) durchführen. Hierbei werden über eine dünne Hohlnadel Zellen angesaugt, die dann begutachtet werden.
Sie wollen mehr darüber erfahren, wie eine Biopsie entnommen wird und was anschließend mit den Zell- und Gewebeproben passiert? Auf der Website des Krebsinformationsdienstes, Deutsches Krebsforschungszentrum finden Sie ausführliche Informationen zu Ablauf und Risiken einer Biopsie.
Wie wird Kehlkopfkrebs behandelt?
Bei vielen Patientinnen und Patienten ist bereits vor Beginn der Behandlung eine logopädische und zahnärztliche Untersuchung oder auch eine Ernährungsberatung sinnvoll.
Für Kehlkopftumoren gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Oberstes Ziel der Therapie ist dabei stets, den Tumor bestmöglich zu behandeln, dabei jedoch möglichst auch die Funktion des Kehlkopfs zu erhalten. Die Behandlung richtet sich nach
- dem allgemeinen Gesundheitszustand
- der Ausbreitung des Tumors
- möglichen Therapiefolgen
- den Wünschen der Patientin oder des Patienten
Video Wie wird Krebs behandelt?
Im folgenden Video erfahren Sie, wie Krebserkrankungen behandelt werden können.
Dieses und weitere Videos gibt es auch auf YouTube
Jetzt ansehenEs gelten die dort bekanntgegebenen Datenschutzhinweise.
Behandlung des Kehlkopftumors
Kehlkopfkrebs im Frühstadium kann in der Regel entweder durch eine Operation oder durch eine Strahlentherapie geheilt werden. Nur wenn Tumoren unterhalb der Stimmlippen wachsen, empfehlen Fachleute in der Regel, den Kehlkopf vollständig zu entfernen. Zwar sind diese Tumoren sehr selten, sie wachsen aber meist besonders aggressiv.
Auch bei fortgeschrittenen Tumoren gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, die die Erkrankung heilen sollen:
- Bei einer Operation soll der Tumor vollständig entfernt werden. Meist ist es dafür notwendig, den kompletten Kehlkopf zu entfernen.
- In der Regel wird der operierte Bereich zusätzlich bestrahlt. Bei einem erhöhten Rückfallrisiko bekommen Patientinnen und Patienten außerdem noch eine Chemotherapie, die die Wirkung der Strahlentherapie verstärken soll.
- Ist eine Operation nicht möglich oder lehnt die Patientin oder der Patient sie ab? Dann kommt eine Strahlentherapie des Tumors und des Halses infrage, die in der Regel mit einer Chemotherapie kombiniert wird, seltener auch mit einer Antikörpertherapie.
Die Vor- und Nachteile jeder Therapiemöglichkeit sollten Betroffene mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten genau besprechen. Auch zur Frage, ob und – wenn ja – unter welchen Bedingungen der Kehlkopf erhalten werden kann, können sich Betroffene in einem solchen Gespräch informieren.
Wichtig zu wissen: Wird bei der Operation der Kehlkopf entfernt, verlieren Patientinnen und Patienten ihre normale Stimme und ihr Riechvermögen. Auch die Atmung verändert sich: Sie erfolgt dann über ein Tracheostoma, eine neu geschaffene Verbindung zur Luftröhre im unteren Halsbereich.
Behandlung der Halslymphknoten
Fachleute empfehlen in der Regel, die Halslymphknoten vorsorglich zu entfernen oder zu bestrahlen – auch, wenn bei den Untersuchungen keine verdächtigen Halslymphknoten festgestellt wurden. Denn häufig gibt es bereits versteckte Lymphknotenmetastasen.
Nur wenn der Kehlkopfkrebs an den Stimmlippen wächst und sich noch im Frühstadium befindet, ist das Risiko für versteckte Metastasen gering. Dann ist eine solche Behandlung nicht notwendig.
Wurden durch die Untersuchungen bereits auffällige Halslymphknoten gefunden? Dann entfernen die Chirurginnen und Chirurgen bei der Operation die Lymphknoten des Halses etwas umfangreicher. Gegebenenfalls müssen sie auch anderes Gewebe mit entfernen. Falls eine Operation nicht möglich oder von den Betroffenen nicht gewünscht ist, kommt eine Strahlentherapie der Halslymphknoten – gegebenenfalls mit einer zusälichen Chemotherapie – zum Einsatz.
Behandlung bei nicht heilbarem Kehlkopfkrebs
In dieser Situation ist das wichtigste Therapieziel, den Tumor zurückzudrängen und das Krebswachstum zu bremsen, um das Überleben der Patentin oder des Patienten zu verlängern. Gleichzeitig sollen Beschwerden so gut wie möglich gelindert werden. Es wird individuell festgelegt, wie die Therapie aussieht. In Frage kommen können:
- eine Chemotherapie
- eine zielgerichtete Therapie
- eine Immuntherapie
- eine Strahlentherapie
- Operationen
Wichtig ist in der Regel eine frühzeitige unterstützende (supportive) Therapie, wie zum Beispiel eine Schmerztherapie, eine Ernährungsberatung oder eine psychoonkologische Begleitung.
Sie möchten mehr über die Behandlung von Kehlkopfkrebs wissen? Welche Nebenwirkungen möglich sind und wie man mit belastenden Beschwerden umgehen kann? Hierzu informiert Sie kostenfrei der Krebsinformationsdienst, Deutsches Krebsforschungszentrum.
Insbesondere wenn das Sprechen schwerfällt, können Sie den E-Mail-Service nutzen. Aber auch am Telefon erhalten Sie individuell zugeschnittene Informationen.
Wie geht es nach der Behandlung von Kehlkopfkrebs weiter?
Die Behandlung einer Krebserkrankung kann für Körper und Seele sehr anstrengend sein. Eine medizinische Rehabilitation (Reha) nach einer Krebstherapie soll Patientinnen und Patienten helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Darüber hinaus soll sie dabei unterstützen, mit Krankheits- und Behandlungsfolgen bestmöglich umgehen zu können.
Daher orientiert sich das Programm einer medizinischen Reha an der persönlichen Krankheitsgeschichte und den individuellen Einschränkungen. Mögliche Maßnahmen für Betroffene mit Kehlkopfkrebs sind:
- eine Stimmrehabilitation
- eine Schluck- und Sprachtherapie
- eine Ernährungstherapie und/oder
- eine psychoonkologische Betreuung
Nachsorge
Die Nachsorge bei Kehlkopfkrebs hat verschiedene Ziele. Sie dient vor allem dazu, einen Rückfall, mögliche Zweitkarzinome sowie Nebenwirkungen und Langzeitfolgen der Behandlung frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Dafür werden Betroffene nach Therapieende regelmäßig untersucht, zunächst in kurzen, dann in größeren Abständen. Bei Beschwerden können sie aber auch öfter zur Nachsorge gehen.
Zum Nachsorgetermin gehören immer:
- eine genaue Befragung über den allgemeinen Gesundheitszustand, Beschwerden und Therapiefolgen (Anamnese)
- eine gründliche Hals-Nasen-Ohren-ärztliche Untersuchung
- Abtasten und Ultraschall des Halses
Abhängig vom individuellen Tumor, dem Rückfallrisiko und der Therapie können Ärztinnen und Ärzte regelmäßig eine Computertomographie (CT) oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) veranlassen. Gegebenenfalls kann auch eine Positronen-Emissions-Tomographie (PET/CT) hinzukommen.
Kann der Krebs nicht geheilt werden? Dann helfen Verlaufskontrollen und eine regelmäßige Betreuung dabei, belastende Symptome frühzeitig zu erkennen und zu lindern. Dies soll die Lebensqualität von Patienten und Patientinnen möglichst lange erhalten.
Was ändert sich mit oder nach Kehlkopfkrebs?
Mit oder nach Kehlkopfkrebs wieder in den Alltag zurückzufinden, ist für Patienten nicht immer einfach. Eine Krebserkrankung und deren Behandlung kann mit einschneidenden Veränderungen einhergehen. Was helfen kann, besser mit der Erkrankung und möglichen Therapiefolgen zurechtzukommen, hängt von der individuellen Situation ab.
Je nach Therapie können unter anderem folgende Probleme auftreten:
- Stimmstörungen oder auch Stimmverlust
- Schluckstörungen
- Verlust des normalen Riechvermögens
- Mundtrockenheit
- Veränderungen an Zähnen und Kiefer
- Probleme beim Kauen
- Lymphödeme im Gesichts- und Halbereich
Betroffene, deren Kehlkopf bei der Operation entfernt wurde, müssen neue Techniken der Stimmbildung erlernen. Außerdem müssen sie lernen, mit einer künstlichen Verbindung zur Luftröhre (Tracheostoma) umzugehen.
Bei Bedarf nach Unterstützung sprechen Sie mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten, welche Möglichkeiten es gibt. Auch Selbsthilfegruppen und Patientenverbände können helfen.
Wer sind geeignete Ansprechpartner für Kehlkopfkrebs?
Bei der Behandlung von Kehlkopfkrebs arbeiten Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen eng zusammen. Krankenhäuser, die besonders viel Erfahrung bei der Behandlung von Kehlkopfkrebs haben, können sich dies durch eine Zertifizierung bestätigen lassen. Die Deutsche Krebsgesellschaft prüft dabei regelmäßig die Einhaltung bestimmter fachlicher Anforderungen.
Die Adressen der zertifizierten Zentren finden Sie auf der Internetseite OncoMAP.
Sie haben weitere Fragen zum Umgang mit der Erkrankung im Alltag und zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten? Hierzu finden Sie Informationen auf der Website des Krebsinformationsdienstes, Deutsches Krebsforschungszentrums.
Bei allen Fragen zu Kehlkopfkrebs können Sie sich auch persönlich an die Ärztinnen und Ärzte des Krebsinformationsdienstes wenden: unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 - 420 30 40 oder per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de.
- Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF. Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Larynxkarzinoms. S3-Leitlinie. Langversion 1.1. AWMF-Registernummer: 017/076OL. November 2019. Aufgerufen am 08.12.2023.
- Zentrum für Krebsregisterdaten (ZfKD) des Robert Koch-Instituts (RKI). Kehlkopfkrebs (Larynxkarzinom). Aufgerufen am 08.12.2023.
In Zusammenarbeit mit dem Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums.
Stand: