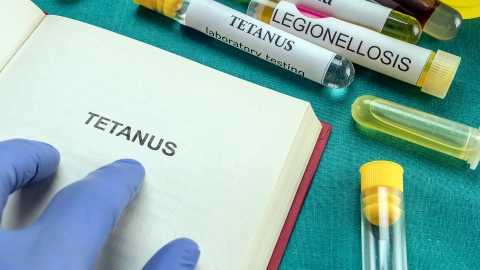Krankheiten Diphtherie
ICD-Codes: A36 Z22.2 Was sind ICD-Codes?
Diphtherie ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die vornehmlich die Haut oder den Rachen betrifft. Die Diphtherie-Erreger produzieren ein Gift, das in den Blutkreislauf gelangen und innere Organe schädigen kann. Selten verläuft die Erkrankung tödlich. Mit einer Impfung kann man sich schützen.
Auf einen Blick
- Diphtherie ist eine schwere bakterielle Infektionskrankheit, ausgelöst durch Corynebakterien.
- Die Bakterien befallen hauptsächlich die Haut (Hautdiphtherie), seltener die Schleimhäute der Atemwege (Rachendiphtherie).
- Zudem produzieren die Bakterien ein Gift (Toxin), das sich im gesamten Körper verteilen und wichtige Organe schädigen kann.
- Diphtherie wird mit Gegengift und Antibiotika behandelt.
- Mit einer Impfung kann man sich wirksam vor Diphtherie schützen.
Hinweis: Die Informationen dieses Artikels können und sollen einen Arztbesuch nicht ersetzen und dürfen nicht zur Selbstdiagnostik oder -behandlung verwendet werden.

Was ist Diphtherie?
Diphtherie ist eine weltweit verbreitete bakterielle Infektionskrankheit. In Deutschland kommt sie aufgrund von Schutzimpfungen mittlerweile nur noch selten vor.
Die Bakterien befallen die Haut oder die Schleimhäute der Atemwege. Zudem produzieren sie ein Gift (Toxin), das sich im ganzen Körper verteilen und wichtige Organe schädigen kann.
Mit einer Impfung kann man sich vor Diphtherie schützen.
Formen der Diphtherie
Bei Diphtherie unterscheidet man hauptsächlich zwei Formen:
- Rachendiphtherie: Die Bakterien setzen sich in den Atemwegen fest und verursachen dort Beschwerden. Diese Form kann tödlich verlaufen: Schätzungen zufolge sterben daran 5 bis 10 von 100 erkrankten Menschen.
- Hautdiphtherie: Dazu kann es nach kleineren oberflächlichen Verletzungen oder Insektenstichen kommen. Sie tritt häufig in Verbindung mit schlechten hygienischen Bedingungen auf. Haus- und Nutztiere können eine Infektionsquelle sein.
Wie äußert sich Diphtherie?
Die Symptome bei Diphtherie unterscheiden sich je nach der Form der Erkrankung und verlaufen verschieden schwer.
Symptome bei Rachendiphtherie
Rachendiphtherie äußert sich durch Beschwerden wie:
- Schwäche
- Halsschmerzen
- Fieber
- Schluckbeschwerden
- bellender Husten (Krupp-Husten)
- Atemgeräusche und Kurzatmigkeit
- Heiserkeit bis zum vollständigen Verlust der Stimme
- geschwollene Lymphknoten am Hals
- süßlich-fauliger Atemgeruch
- blaurote Verfärbung der Haut (Zyanose)
- Unruhe und Ängstlichkeit
- Blässe
Das Gift zerstört gesundes Gewebe in den Atemwegen. Innerhalb von 2 bis 3 Tagen bildet das abgestorbene Gewebe einen dicken, grau-braunen Belag, der sich im Rachen oder in der Nase ablagern kann.
Ärztinnen und Ärzte bezeichnen diesen Belag als Pseudomembran. Er kann Gewebe in der Nase, den Mandeln, dem Kehlkopf und im Rachen bedecken, wodurch das Atmen und Schlucken stark erschwert wird. Für Kleinkinder kann das lebensbedrohlich sein.
Symptome bei Hautdiphtherie
Hautdiphtherie zeigt sich durch:
- Schwellung
- Rötung
- Wunden, die wie ausgestanzt wirken
- einen schmierigen Wundbelag
Video Sind Kinderkrankheiten gefährlich?
Im folgenden Video erfahren Sie, welche typischen Kinderkrankheiten es gibt und wie sie sich äußern.
Dieses und weitere Videos gibt es auch auf YouTube
Jetzt ansehenEs gelten die dort bekanntgegebenen Datenschutzhinweise.
Wie bekommt man Diphtherie?
Rachendiphtherie wird durch das Bakterium Corynebacterium diphtheriae ausgelöst. Dieses Bakterium kommt nur beim Menschen vor.
Auslöser von Hautdiphtherie sind die Bakterien Corynebacterium ulcerans und Corynebacterium pseudotuberculosis. Diese beiden Bakterienarten kommen natürlicherweise nur in Tieren vor. Es handelt sich bei Hautdiphtherie daher um eine Zoonose, also um eine von Tieren auf den Menschen übertragene Krankheit.
Wie werden die Diphtherie-Erreger übertragen?
Rachendiphtherie wird durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen: Spricht, niest oder hustet eine infizierte Person, gibt sie erregerhaltige Tröpfchen ab. Diese können sich über die Luft verteilen und von anderen Menschen eingeatmet werden. Gelegentlich kommt es vor, dass Menschen infolge einer Hautdiphtherie an Rachendiphtherie erkranken.
Hautdiphtherie wird hauptsächlich durch Schmierinfektion übertragen. So kann man sich zum Beispiel anstecken, wenn man eine offene Wunde einer infizierten Person berührt. Man kann aber auch an Diphtherie erkranken, wenn man Gegenstände anfasst, die mit Diphtherie-Erregern verunreinigt sind. Das spielt vor allem in Lebenssituationen mit schlechten hygienischen Bedingungen eine Rolle, zum Beispiel bei Obdachlosigkeit.
Wie häufig tritt Diphtherie auf?
Infektionen mit dem Diphtherie-Erreger sind weltweit verbreitet. Am häufigsten tritt Diphtherie in subtropischen Ländern wie Indien auf. Außerdem kommt die Erkrankung in vielen Ländern Afrikas, Asiens, des Südpazifiks und in Osteuropa vor.
Die schwerwiegenden Krankheitsfolgen sind aber durch Säuglings- und Kinderimpfprogramme stark zurückgegangen.
Erkrankungen in Deutschland
In Deutschland ist Diphtherie meldepflichtig. Seit 2010 nimmt die Zahl von Hautdiphtherie-Fällen zu.
Im Jahr 2020 wurden hierzulande 16 Fälle von Diphtherie gemeldet: 15 Personen hatten Hautdiphtherie, eine Person Rachendiphtherie.
Welche Komplikationen sind bei Diphtherie möglich?
Das Gift, das von den Diphtherie-Erregern gebildet wird, kann in den Blutkreislauf gelangen und innere Organe schädigen. Bei solch einem schweren Verlauf sprechen Medizinerinnen und Mediziner von toxischer Diphtherie.
Zu den möglichen Komplikationen gehören:
- blockierte Atemwege
- Lungeninfektion: Lungenentzündung bis hin zum Atemversagen
- Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis)
- Nervenschäden (Polyneuropathie)
- Lähmung
- Koma
Wie lässt sich Diphtherie vorbeugen?
Um zu verhindern, dass sich Diphtherie weiter ausbreitet, ist es wichtig, infizierte Personen und Menschen mit Verdacht auf Diphtherie zu isolieren.
Mit einer Impfung lässt sich Diphtherie wirksam vorbeugen. Die Impfung richtet sich gegen das Gift, nicht gegen die Bakterien. Daher können sich die Erreger trotz Impfung im Körper vermehren und manchmal Symptome wie Fieber oder allgemeine Schwäche auslösen.
Der Diphtherie-Impfstoff basiert auf dem Gift des Rachendiphtherie-Erregers. Dieses Gift ähnelt dem Gift des Hautdiphtherie-Erregers. Wie gut die Impfung gegen Hautdiphtherie wirkt, ist jedoch unklar.
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, alle Säuglinge, Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen standardmäßig gegen Diphtherie zu impfen.
Impfempfehlungen
Säuglinge sollten im Alter von 2, 4 und 11 bis 14 Monaten die ersten Dosen erhalten. Dafür kommt üblicherweise ein Sechsfachimpfstoff zum Einsatz, der gleichzeitig gegen Tetanus, Keuchhusten (Pertussis), Kinderlähmung (Polio), Hepatitis B und gegen eine Infektion mit dem Bakterium Haemophilus influenzae Typ b und schützt.
Der Impfschutz durch diese Grundimmunisierung lässt mit der Zeit nach. Daher sollte im Alter von 5 bis 6 Jahren eine erste Auffrischungsimpfung erfolgen und im Alter von 9 bis 17 eine zweite.
Danach wird geraten, den Impfschutz alle 10 Jahre zu erneuern. Für die Auffrischungsimpfung stehen verschiedene Einzel- und Kombinationsimpfstoffe zur Verfügung.
Sie haben Fragen zur Diphtherie-Impfung und den Empfehlungen der STIKO? Antworten auf häufige Fragen finden Sie auf der Website des Robert-Koch-Instituts.
Video Wie funktioniert eine Impfung?
Im folgenden Video erfahren Sie, wie eine Impfung funktioniert.
Dieses und weitere Videos gibt es auch auf YouTube
Jetzt ansehenEs gelten die dort bekanntgegebenen Datenschutzhinweise.
Wie wird Diphtherie diagnostiziert?
Ärztinnen und Ärzte diagnostizieren Diphtherie in der Regel durch eine körperliche Untersuchung. Um einen Verdacht zu bestätigen, ist es wichtig, den Erreger nachzuweisen. Dafür nimmt die Ärztin oder der Arzt einen Abstrich aus dem hinteren Rachenraum oder einen Wundabstrich und sendet diesen in ein Labor.
Dort wird zum Nachweis des Erregers eine Bakterienkultur angelegt. Außerdem lässt sich der Erreger durch molekularbiologische Methoden wie dem PCR-Test bestimmen. Dabei werden nicht die Bakterien selbst, sondern deren Erbsubstanz nachgewiesen.
Wie wird Diphtherie behandelt?
Für das Diphtherie-Gift gibt es ein Gegengift. Allerdings kann das Gegengift nicht mehr wirken, wenn das Gift bereits an Körperzellen binden konnte.
Daher warten Medizinerinnen und Mediziner bei einem Verdacht auf Diphtherie nicht auf die Laborergebnisse, sondern beginnen sofort mit der Behandlung.
Behandlung mit Gegengift
Hautdiphtherie ist nicht so bedrohlich wie Rachendiphtherie. Daher wird das Gegengift bei Hautdiphtherie nur dann verabreicht, wenn die Wunden und Geschwüre größer als eine Euro-Münze sind und den typischen graubraunen Belag haben.
Wichtig zu wissen: Das Gegengift wird in der Regel aus Pferden gewonnen. Manche Menschen reagieren allergisch auf diese Substanz, was zu Komplikationen führen kann. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer lebensbedrohlichen allergischen Überreaktion (anaphylaktischen Schock). Daher werden Menschen mit Verdacht auf Diphtherie in einem Krankenhaus mit intensivmedizinischer Versorgung behandelt.
Behandlung mit Antibiotika
Zusätzlich zum Gegengift verabreichen Ärztinnen und Ärzte Antibiotika, um noch lebende Bakterien abzutöten.
Menschen mit Diphtherie sind in der Regel 48 Stunden, nachdem sie Antibiotika eingenommen haben, nicht mehr ansteckend.
Es ist jedoch wichtig, die Antibiotika länger einzunehmen, in der Regel für zwei Wochen. So wird sichergestellt, dass alle Bakterien vollständig aus dem Körper entfernt beziehungsweise abgetötet wurden.
Danach wiederholen Ärztinnen und Ärzte die Tests, um zu schauen, ob auch alle Erreger aus dem Körper verschwunden sind.
Enge Kontaktpersonen mit Verdacht auf Diphtherie erhalten in der Regel vorbeugend Antibiotika. Medizinerinnen und Mediziner sprechen hier von einer postexpositionellen Prophylaxe (PEP).
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. Diphtheria. Aufgerufen am 17.02.2023.
- Konrad R, Hörmansdorfer S, Sing A. Possible human-to-human transmission of toxigenic Corynebacterium ulcerans. Clin Microbiol Infect. 2015 Aug;21(8):768-71. doi: 10.1016/j.cmi.2015.05.021.
- Robert Koch-Institut (RKI). Epidemiologisches Bulletin. Corynebacterium ulcerans – ein Emerging Pathogen? 22. Februar 2018/Nr. 8.
- Robert Koch-Institut (RKI). Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten für 2020.
- Robert-Koch-Institut (RKI). RKI-Ratgeber: Diphtherie. Aufgerufen am 17.02.2023.
Geprüft durch die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie e.V.
Stand: